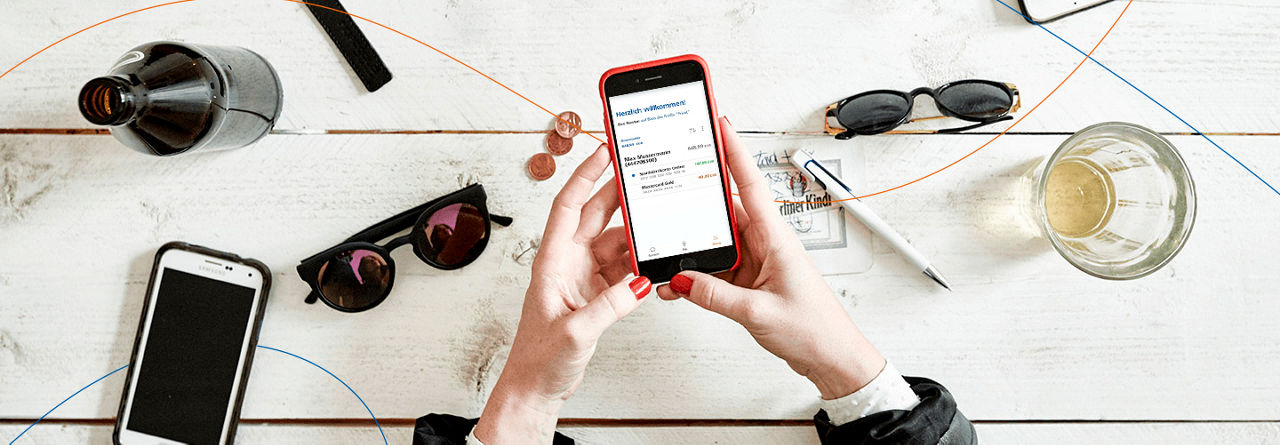Freiwillige Einlagensicherungsfonds und ihre Bedeutung
Einer davon ist zum Beispiel der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB). Bei dessen Mitgliedern handelt es sich um private Banken. Er existiert seit 1976 und wird durch regelmäßige Zahlungen der teilnehmenden Geldinstitute finanziert. Sollten die Mittel im Falle einer Entschädigung nicht vollständig ausreichen, greift für die Mitglieder eine sogenannte Nachschusspflicht. Bis heute konnten Kunden auf diese Weise in allen Fällen zu 100 Prozent entschädigt werden (Einlagensicherungsfonds.de. 2025.). Sparkassen, Genossenschaftsbanken sowie Öffentliche Banken (Landes- und Förderbanken) unterhalten ebenfalls eigene Sicherungssysteme. Die amtlich anerkannte Institutssicherung des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) greift beispielsweise nach den gesetzlichen Vorgaben bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken, den Sparda-Banken, den genossenschaftlichen Zentralbanken sowie den Hypothekenbanken. Parallel dazu besteht hier aber auch noch die Sicherungseinrichtung des BVR, welche die Aufgabe hat, bereits bestehende oder drohende wirtschaftliche Schwierigkeiten der Institute zu beheben oder abzuwenden. Das heißt, sollte ein angeschlossenes Institut tatsächlich in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, kann die Sicherungseinrichtung des BVR die Einlagen auch über den gesetzlichen Schutz hinaus absichern. Auch hier hat es seit der Gründung, und das ist seit immerhin 1934, nicht einen einzigen Fall gegeben, in dem ein Kontoinhaber finanzielle Verluste hinnehmen musste (Sparda.de. 2025). Das unterstreicht die hohe Stabilität und Vertrauenswürdigkeit des Systems, dem auch wir angehören.